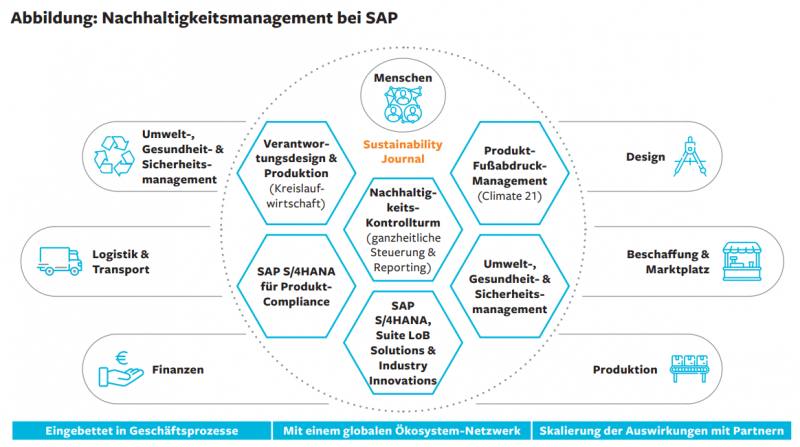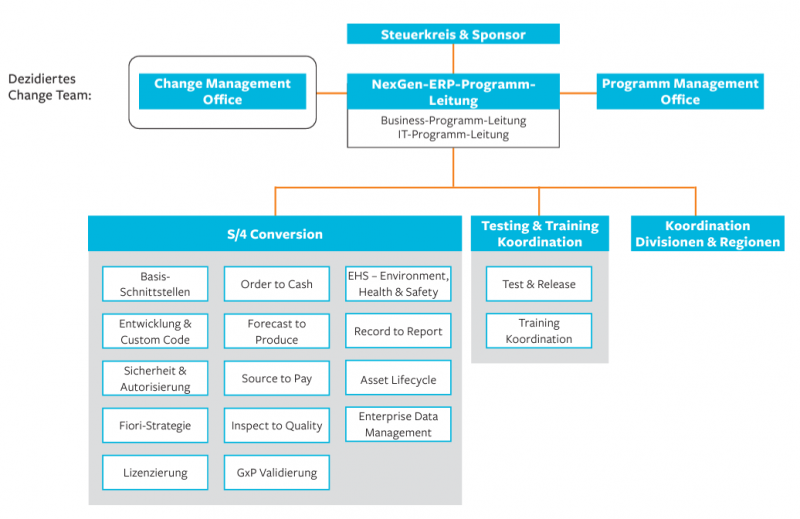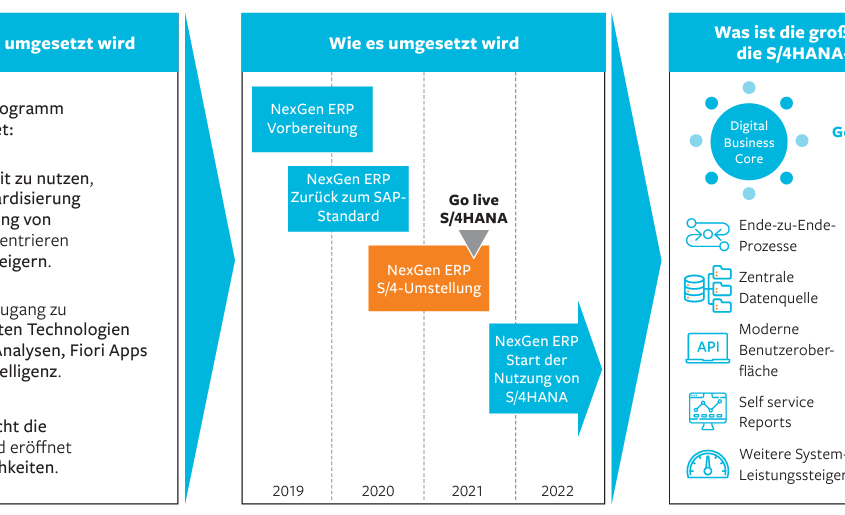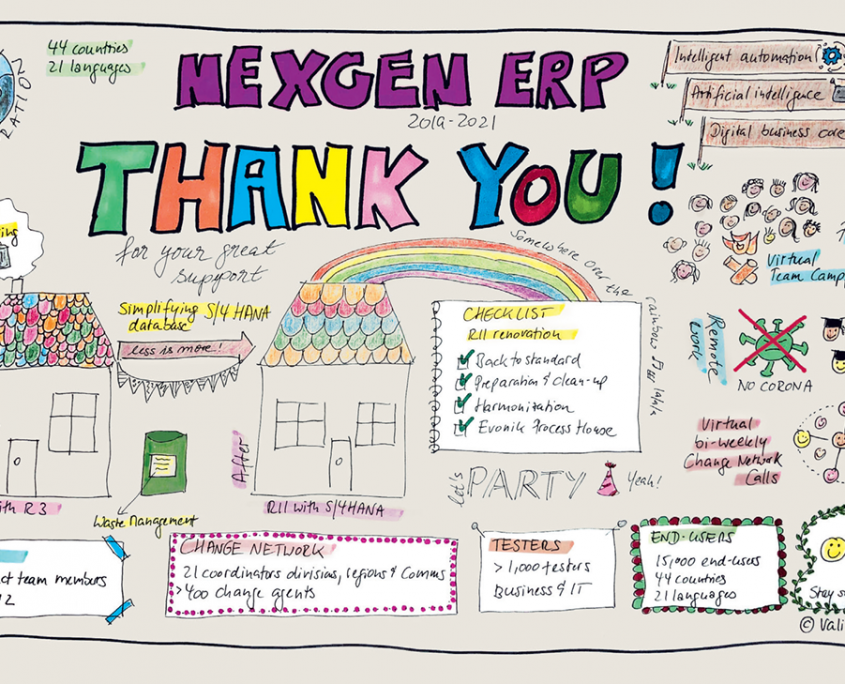Da besteht kein Zweifel: Unternehmen müssen möglichst kundenorientiert handeln und für positive Kundenerlebnisse sorgen. Doch dass der beste Weg zu begeisterten Kunden über begeisterte Mitarbeiter führt, ist nicht immer allen Führungskräften bewusst. Dabei ist die Gestaltung positiver Mitarbeitererlebnisse mithilfe von Employee Experience Design ein entscheidender Erfolgsfaktor für ein Unternehmen.
Max ist auf der Suche nach einem neuen Bett. Aus nachhaltig produziertem Holz soll es sein, gut verarbeitet und 1,60 m breit. An den Ausstellungsstücken im Möbelhaus findet er die nötigen Informationen leider nicht. Unsicher läuft er durch die Etage und sucht nach jemandem, der ihm helfen kann: „Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche ein Bett.“ „Ich bin nur für Schreibtische verantwortlich. Fragen Sie jemanden in der Betten-Abteilung“, tönt es zurück. Nächster Versuch: „Hallo, ich suche ein Holzbett, 1,60 m breit, stabil und aus nachhaltigem Holz“. „Die Betten dort drüben sind fast alle in der Größe verfügbar. Zu den Materialien kann ich Ihnen nix sagen, aber schauen Sie doch mal auf Google.“ Max schaut verdutzt aus der Wäsche. Zahlreiche Google-Anfragen später versucht er es nochmal. Diesmal fragt er, ob das Möbelhaus auch eine Finanzierung anbietet. „Das prüft eine andere Abteilung, nachdem der Kaufvertrag abgeschlossen ist“, heißt es. „Na toll, das bringt mir jetzt auch nichts – und die Lieferzeit?“. „Die Lieferzeit beträgt 12 Wochen. Wenn Sie das Bett aufgebaut bekommen wollen, würde noch eine Servicegebühr anfallen.“ Frustriert tritt Max den Heimweg an und nutzt die Fahrt, um auf seinem Smartphone nach einem neuen Bett zu suchen, das seinen Wünschen entspricht – bei einem Online-Möbelhändler.
Die Geschichte von Max ist die Geschichte einer negativen Customer Experience (CX). Für das Möbelhaus eine vergebene Chance, ihn mit gutem Service zu begeistern und im Wettbewerb mit Online-Händlern die eigenen Trümpfe auszuspielen. Was wir nicht wissen: Die Geschichte von Max ist auch die Geschichte einer schlechten Employee Experience (EX) von Ayse, Tim und Daniela:
- Ayse ist frustriert, weil sie kurzfristig für die Schicht einer Kollegin einspringen musste. Ihr Chef hat die Schicht mal wieder falsch geplant. Sie arbeitet normalerweise in der Beleuchtungsabteilung und hat von Betten wenig Ahnung.
- Tim ist seit vier Wochen im Unternehmen und fühlt sich bei der Frage des Kunden ziemlich hilflos. Bis heute hat er von seinem Chef keine inhaltliche Einführung bekommen. Die Google-Recherche ist seine Lösung, um überhaupt an Infos zu den Produkten zu kommen.
- Daniela arbeitet seit 20 Jahren im Unternehmen. Sie kennt das Unternehmen wie ihre Westentasche. Dennoch hat sie das Gefühl, dass ihr Arbeitgeber ihre Erfahrung nicht zu schätzen weiß. Als die neue Geschäftsführerin eine Unternehmensberatung beauftragte, die Zahlungsprozesse zu überarbeiten, wurde sie nicht einbezogen. Jetzt wurden ein neues Rechnungstool eingeführt und die Zahlungsprozesse in eine neue Abteilung verlagert. Daniela kann nicht viel mehr tun, als Max an die andere Abteilung zu verweisen.
Ayse, Tim und Daniela hätten die Customer Experience von Max positiv beeinflussen können. Keiner von den Dreien hat sich besonders kundenorientiert verhalten. Aber können wir ihnen einen Vorwurf machen? Oder sind sie selbst Opfer eines Systems, das nicht darauf ausgelegt ist, den Menschen darin – egal ob Kunde oder Mitarbeiter – eine positive Experience zu bieten?
Mitarbeiter wie Kunden behandeln
Eine kundenorientierte Haltung und kundenorientiertes Verhalten sind auch das Resultat zufriedener Mitarbeiter: Mitarbeiter, die sich wohl fühlen und denen es gut geht, können ihre volle Aufmerksamkeit dem Kunden widmen und handeln selbst kundenorientiert. Sie identifizieren sich mit dem Unternehmen, streben danach, einen guten Job zu machen und können ihre Energie selber darauf ausrichten, ein positives Kundenerlebnis zu schaffen.
Organisationen, die eine positive Customer Experience gestalten möchten, sollten daher bei der Employee Experience anfangen. Dabei geht es darum, Mitarbeiter wie Kunden zu behandeln. Kunden, deren Zufriedenheit durch ihre Erlebnisse geprägt werden, um deren Treue und Loyalität man im Wettbewerb steht, und die sich jeden Arbeitstag von neuem für den Arbeitgeber entscheiden. Wenn sich diese Erkenntnis im Management findet – in Kombination mit einer kundenorientierten Haltung der Personalabteilung –, ist das der erste Schritt zu einer mitarbeiterorientierten Personalarbeit.
Prozesse sind kein gutes Tool
In der Personalarbeit arbeiten wir gerne mit Prozessen wie zum Beispiel Recruiting-Prozess, Onboarding-Prozess, Entwicklungsprozess, Gehaltsanpassungsprozess, Versetzungsprozess. Prozesse sind toll. Sie ermöglichen uns, Arbeitsabläufe zu standardisieren, Workflows in IT-Lösungen abzubilden, Aufwände und Kosten zu optimieren und Fehlerquellen zu minimieren. Doch ein guter Prozess garantiert noch lange kein gutes Kundenerlebnis. Überhaupt sind Prozesse kein besonders gutes Tool, um ein positives Erlebnis zu gestalten.
Mitarbeiter messen ihre Employee Experience nicht an ihrer Interaktion mit einzelnen HR-Prozessen wie dem letzten Urlaubsantrag oder der letzten Gehaltsabrechnung. Nein, es geht um den aggregierten Gesamteindruck aller Interaktionen und Erfahrungen, die ein Mitarbeiter im Laufe seiner Beschäftigung im und mit dem eigenen Unternehmen und den darin handelnden Akteuren macht.
Besonders prägend sind dabei Momente, in die Mitarbeiter in hohem Maße emotional involviert sind. Diese „moments that matter“ bestimmen, wie sehr sich ein Mitarbeiter im Unternehmen engagiert und wie er oder sie es nach außen hin präsentiert. Auch wenn jeder Mensch seine eigenen „moments that matter“ hat – ein paar Erlebnisse sind für jeden von besonderer Bedeutung: Der erste Tag im Job, jegliche Art von Feedback – besonders wenn es von der Führungskraft kommt –, der Umgang mit privaten Zwischenfällen oder die Kommunikation von organisationalen Veränderungen. Um diese Erlebnisse zu gestalten, müssen Organisationen lernen, sich von der reinen Prozessorientierung zu lösen. Sie müssen dafür die Perspektive des Mitarbeiters einnehmen und die Gestaltung von Erlebnissen zum Ziel machen, die bei Mitarbeitern positive Emotionen auslösen.
EX Design: Mit einer Recherche starten
Ein Ansatz, eine positive Employee Experience (EX) zu gestalten, ist EX Design, also die Nutzung kundenorientierter Entwicklungsmethoden für die Gestaltung unternehmensinterner Abläufe – bekannt unter den Begriffen: Design Thinking, Service Design oder Experience Design. EX Design stellt den Menschen und seine Erfahrungen in den Mittelpunkt.
Ein typisches EX-Design-Projekt startet deshalb mit einer Recherchephase, um den Problemraum genau zu verstehen. Dafür sollte der Dialog mit den Mitarbeitern gesucht werden. Ein erster Schritt zu mehr Mitarbeiterorientierung könnte darin bestehen, Mitarbeiter zu fragen, welche Momente sie als besonders prägend in Erinnerung haben – im Positiven wie im Negativen. Wer hier unvoreingenommen in das Gespräch geht, findet schnell die richtigen Punkte, um das Mitarbeitererlebnis zu verbessern.
Ziel der Recherchephase ist es, die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse – zum Beispiel die Mitarbeiter eines Möbelhauses – besser kennenzulernen. Wer mit Ayse, Tim und Daniela spricht, der stößt schnell auf ihre größten Bedürfnisse: Rücksichtnahme, Befähigung und Wertschätzung.
Besondere Momente identifizieren
Für die Recherche können Nutzer von EX Design auf eine große Bibliothek an Methoden zurückgreifen: Fokusgruppen, Guerilla Research oder mobile Ethnografien. Die Recherchetools sind mannigfaltig. Die Nutzung qualitativer Methoden ist dabei essenziell, nicht nur um zu verstehen, wo das Problem liegt, sondern warum das Problem vorliegt. Für die Strukturierung der Erkenntnisse helfen Personas, System Maps oder Journey Maps. Egal welche Methoden genutzt werden: Am Ende der Recherchephase geht es darum, die zentralen Erkenntnisse herauszuarbeiten und die „moments that matter“ zu identifizieren.
Der zweite Handlungsraum von EX Design ist der Lösungsraum. Hier geht es darum, Ideen zu sammeln, Prototypen zu entwickeln, auszuprobieren und inkrementell zu verbessern. Die Kunst liegt dabei darin, sich nicht in theoretischen Diskussionen um die beste Idee zu verlieren, sondern sich zu trauen, Dinge auszuprobieren, echte Erfahrungen zu sammeln, daraus zu lernen und das Mitarbeitererlebnis Schritt für Schritt zu verbessern.
Nehmen wir Tim und das Beispiel Onboarding: In den meisten größeren Organisationen fängt jeden Monat ein neuer Mitarbeiter an. Das bedeutet jeden Monat eine neue Chance, das beste Onboarding-Erlebnis zu bieten, das wir uns vorstellen können. Zwei Wochen später sollte nach Feedback gefragt und der Onboarding-Ansatz weiterentwickelt werden, sodass es zum nächsten Monatsbeginn wieder die Gelegenheit gibt, den Prototypen auszuprobieren: Test. Refine. Repeat.
Mitarbeiter werden zu Botschaftern
Organisationen, die positive Kundenerlebnisse schaffen möchten, sollten in ihre Employee Experience investieren. Was wir am Beispiel von Max, Ayse, Tim und Daniela gesehen haben, lässt sich auf drei handfeste Zusammenhänge herunterbrechen:
- Mitarbeiter können sich auf ihre Kunden konzentrieren, weil sie sich um alles andere keine Sorgen machen müssen
Organisationen, die alles daransetzen, für ihre Mitarbeiter ein positives Erlebnis zu gestalten, vermitteln eine klare Botschaft: Wir kümmern uns um dich. Diese Sicherheit ermöglicht es den Mitarbeitern, sich voll und ganz auf ihre Kunden zu konzentrieren. Wer sich keine Sorgen machen muss, ob sein Urlaubsantrag genehmigt wird, ob der Chef die Wünsche für die Schichtplanung ignoriert oder ob das nächste Training aus Kostengründen wieder einmal abgesagt wird, ist mit voller Konzentration bei der Arbeit und motiviert, sein Bestes zu geben.
- Mitarbeiter werden zu Botschaftern ihres Unternehmens und spiegeln die kundenorientierte Haltung nach außen
Eine positive Employee Experience führt zu mehr Engagement der Mitarbeiter. Wenn Organisationen ihre Mitarbeiter spüren lassen, dass sie und ihr Erlebnis ihnen wichtig sind, wächst die Identifikation der Mitarbeiter mit dem eigenen Unternehmen und seinen Produkten. Mitarbeiter werden zu stolzen Botschaftern des Unternehmens. Wer positive Erfahrungen macht, möchte diese teilen – mit der Familie, Freunden und natürlich mit den eigenen Kunden. Ganz natürlich und mit Überzeugung überträgt sich die positive Haltung gegenüber dem Unternehmen auf den Kunden.
- Mitarbeiter sorgen dafür, dass unternehmensinterne Abläufe auf den Kunden ausgerichtet sind
Wenn Organisationen ihre internen Prozesse konsequent auf das Kundenerlebnis der eigenen Mitarbeiter ausrichten, färbt dieses Vorgehen auch auf das Handeln der Mitarbeiter ab. Kundenorientierung wird für die Mitarbeiter damit zum Leitmotiv für das eigene Handeln. Sie setzen sich proaktiv für die Gestaltung kundenorientierter Lösungen ein – egal ob in der Abrechnung, im Kundenservice oder im Vertrieb. Dazu trägt auch die Nutzung von EX-Design-Methoden bei. Mitarbeiter, die selbst an Veränderungen beteiligt werden, als Kunden befragt werden, Prototypen entwickeln und ausprobieren, nutzen dieses Vorgehen auch in der Arbeit mit ihren eigenen Kunden.
- Eine positive Employee Experience wirkt sich positiv auf operative KPIs aus
Wer seinen Mitarbeitern eine richtig gute Onboarding Experience bietet, wird merken, dass die Fluktuation in den ersten sechs Monaten spürbar abnimmt. Wer bei der Einsatzplanung die Präferenzen der Mitarbeiter berücksichtigt, wird merken, dass Krankenstand und Fehlraten zurückgehen. Und wer Betroffene zu Beteiligten an Veränderungsprozessen macht, wird merken, dass sich die KPIs zur operativen Leistung der Organisation verbessern. Eine Investition in die Employee Experience ist damit eine Investition in die Business Performance.
Auch wenn es auf den ersten Blick wie ein zusätzliches Investment wirken mag, führt der beste Weg zu begeisterten Kunden über begeisterte Mitarbeiter. Denn eine Investition in eine positive Employee Experience ist eine Investition in die Haltung, in die Methoden und in die Ressourcen der Menschen, die im tagtäglichen Umgang mit ihren Kunden die Wahrnehmung ihrer Marke nach außen prägen. CX und EX sind zwei Seiten einer Medaille.
Autor:
Felicitas von Kyaw ist Präsidiumsmitglied des Bundesverbands der Personalmanager (BPM) sowie Vice President People & Culture, Geschäftsführerin Personal und Arbeitsdirektorin bei Coca-Cola European Partners Deutschland.
Leon Jacob ist Senior Manager und EX Design Lead bei der hkp/// group. Die internationale, partnergeführte Unternehmensberatung ist spezialisiert auf HR-Management und auf die Gestaltung der Employee Experience entlang des Mitarbeiterlebenszyklus.